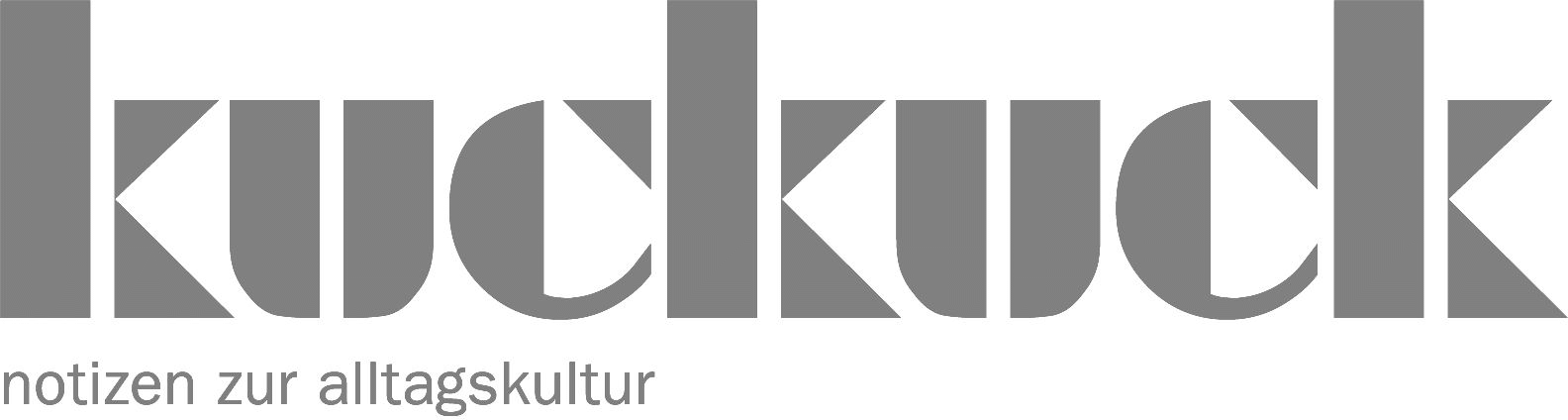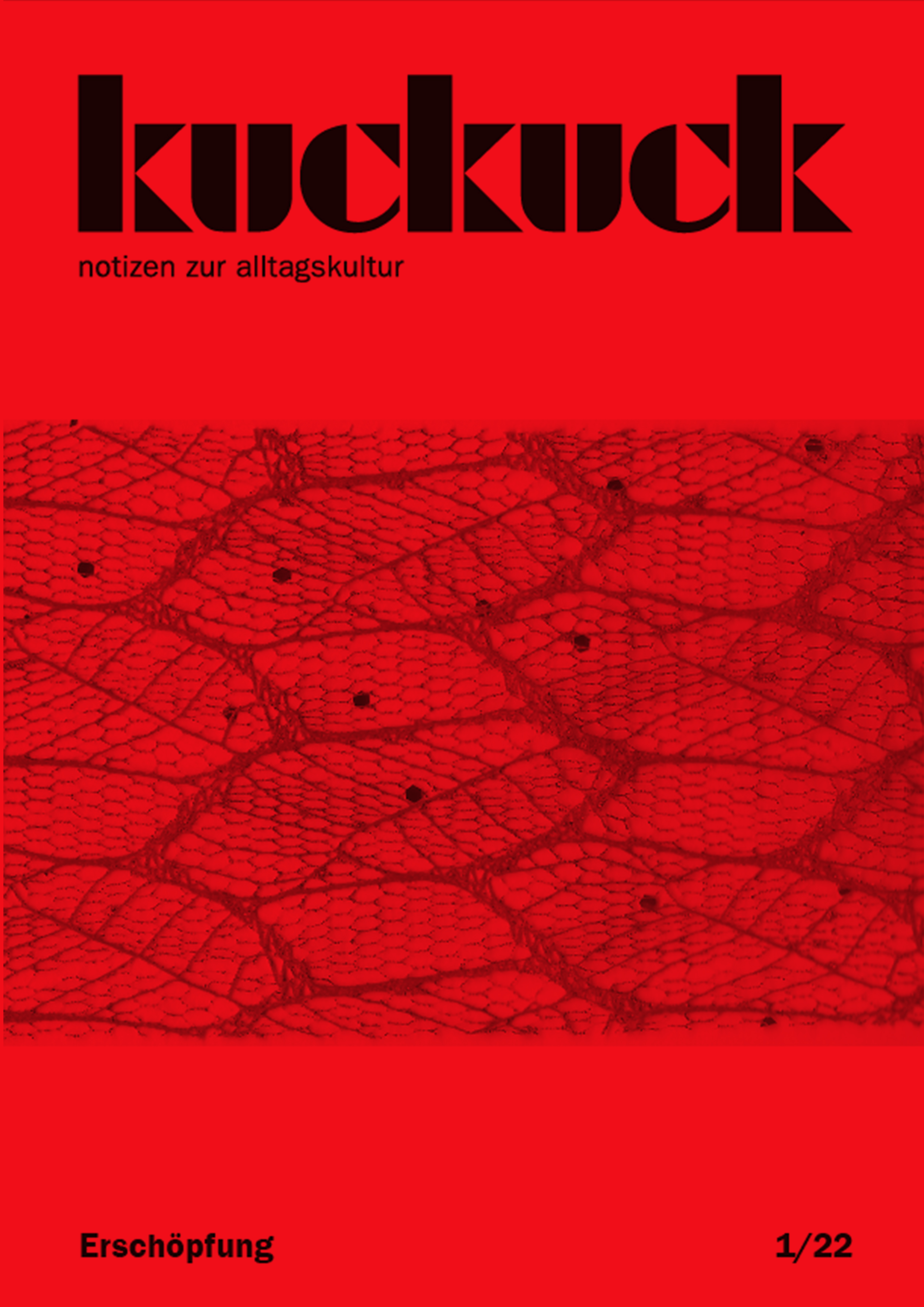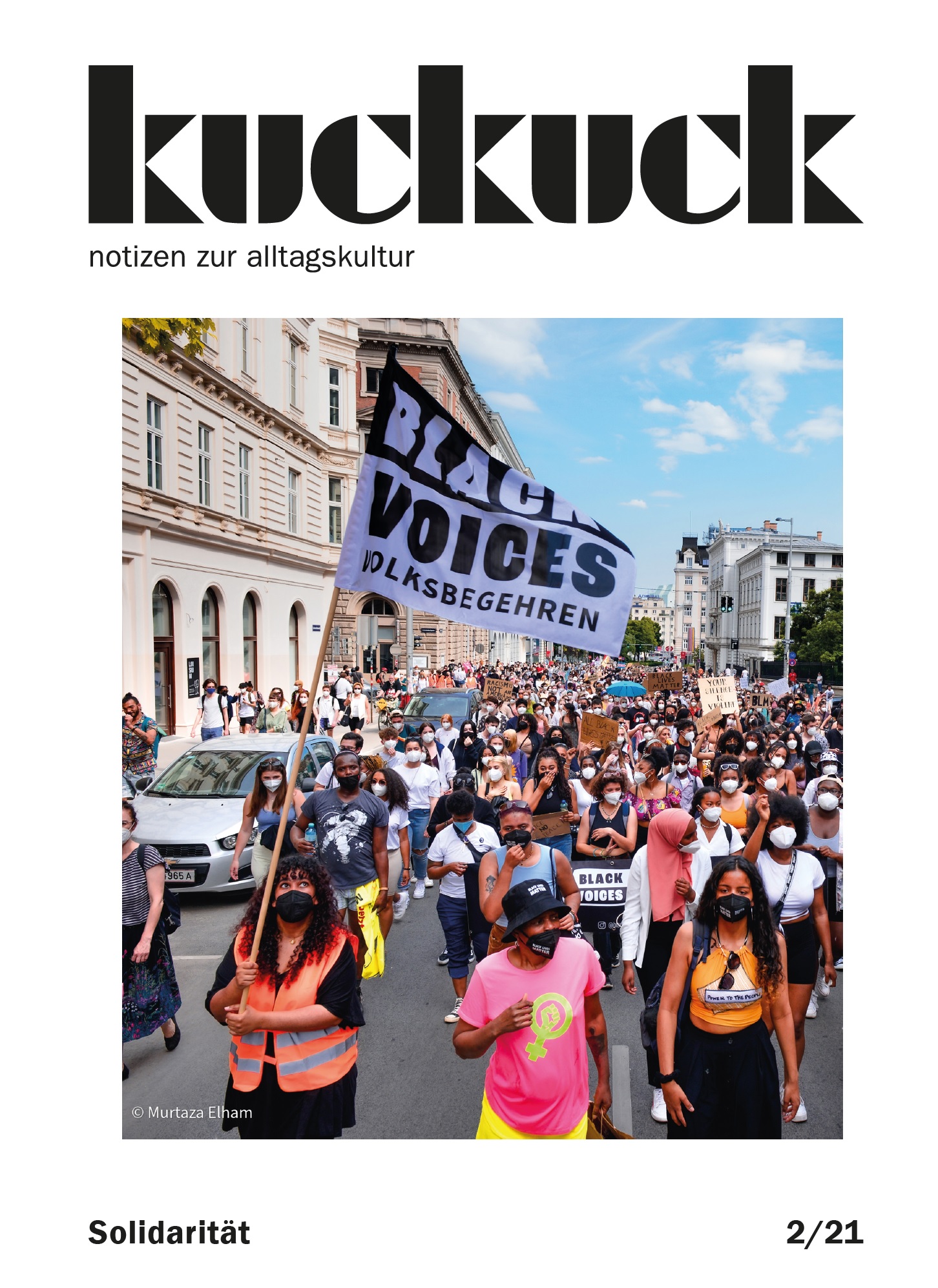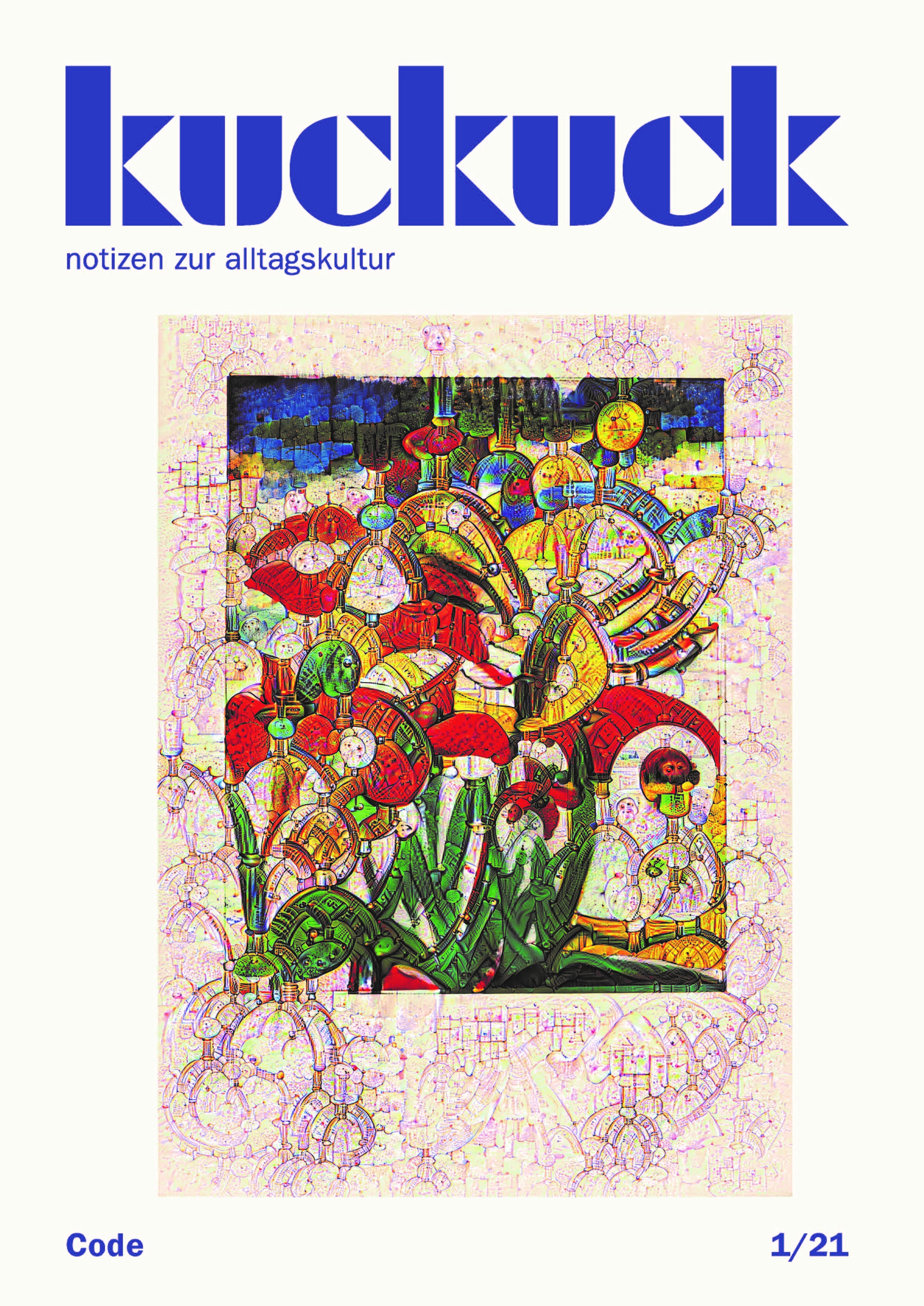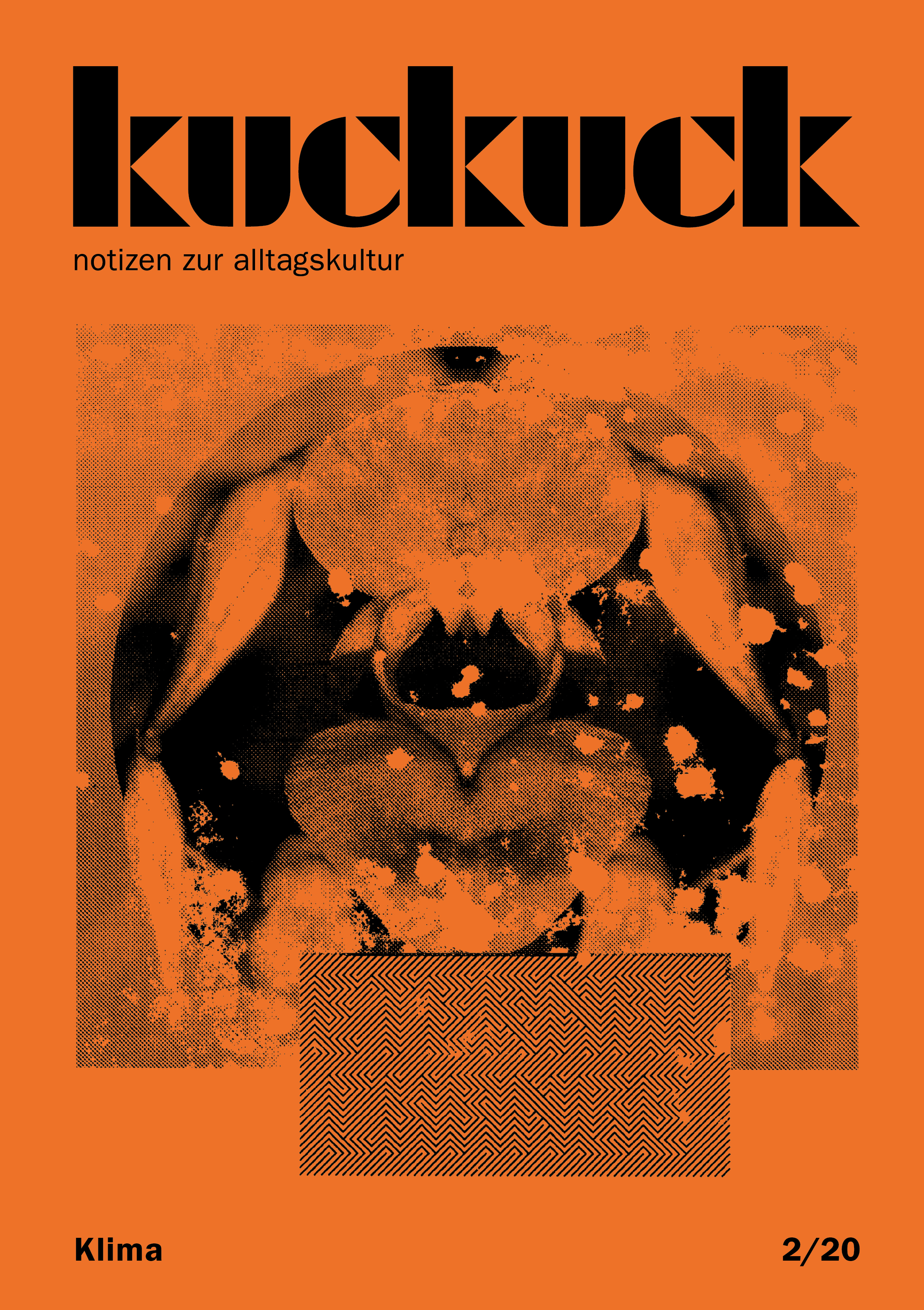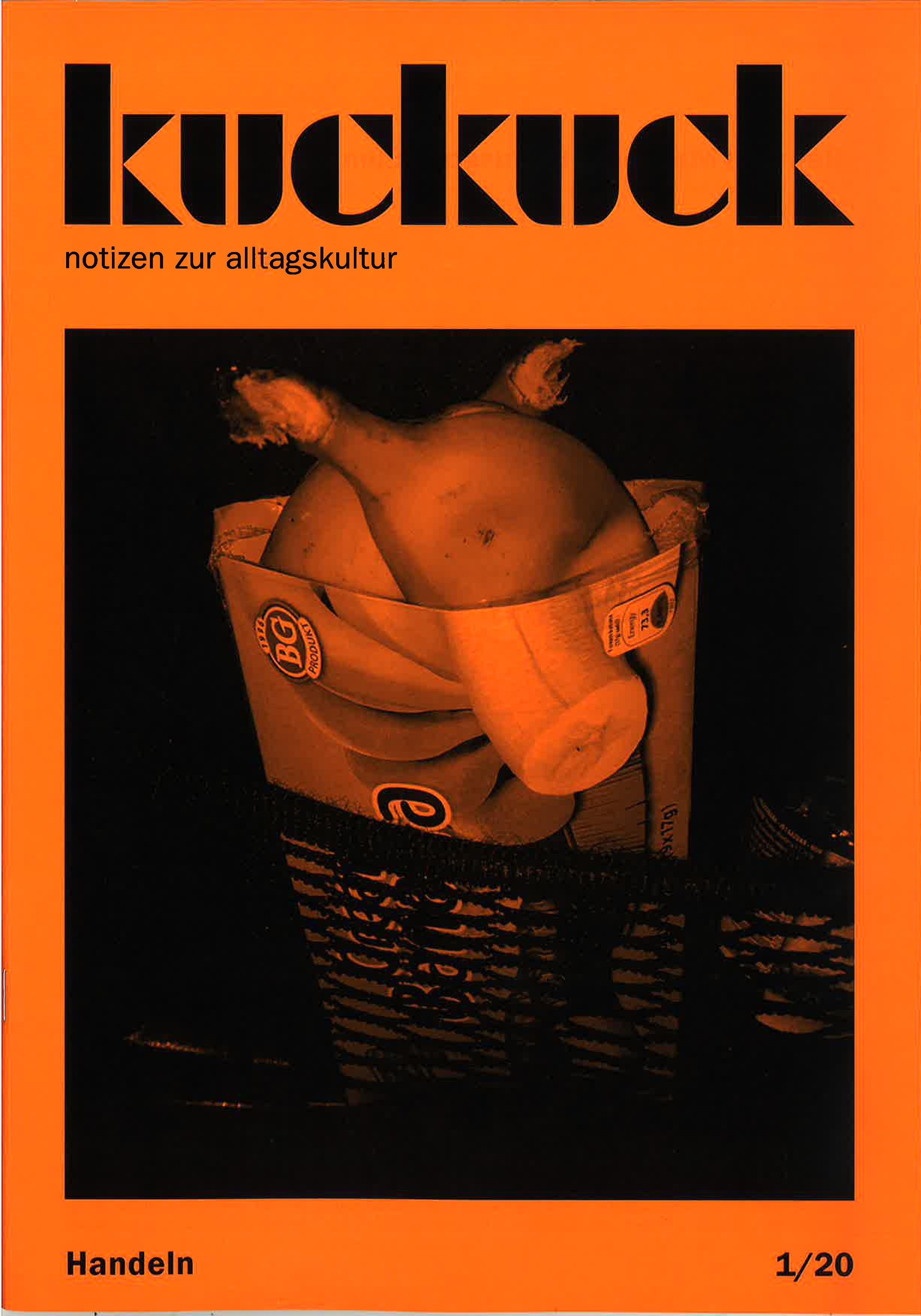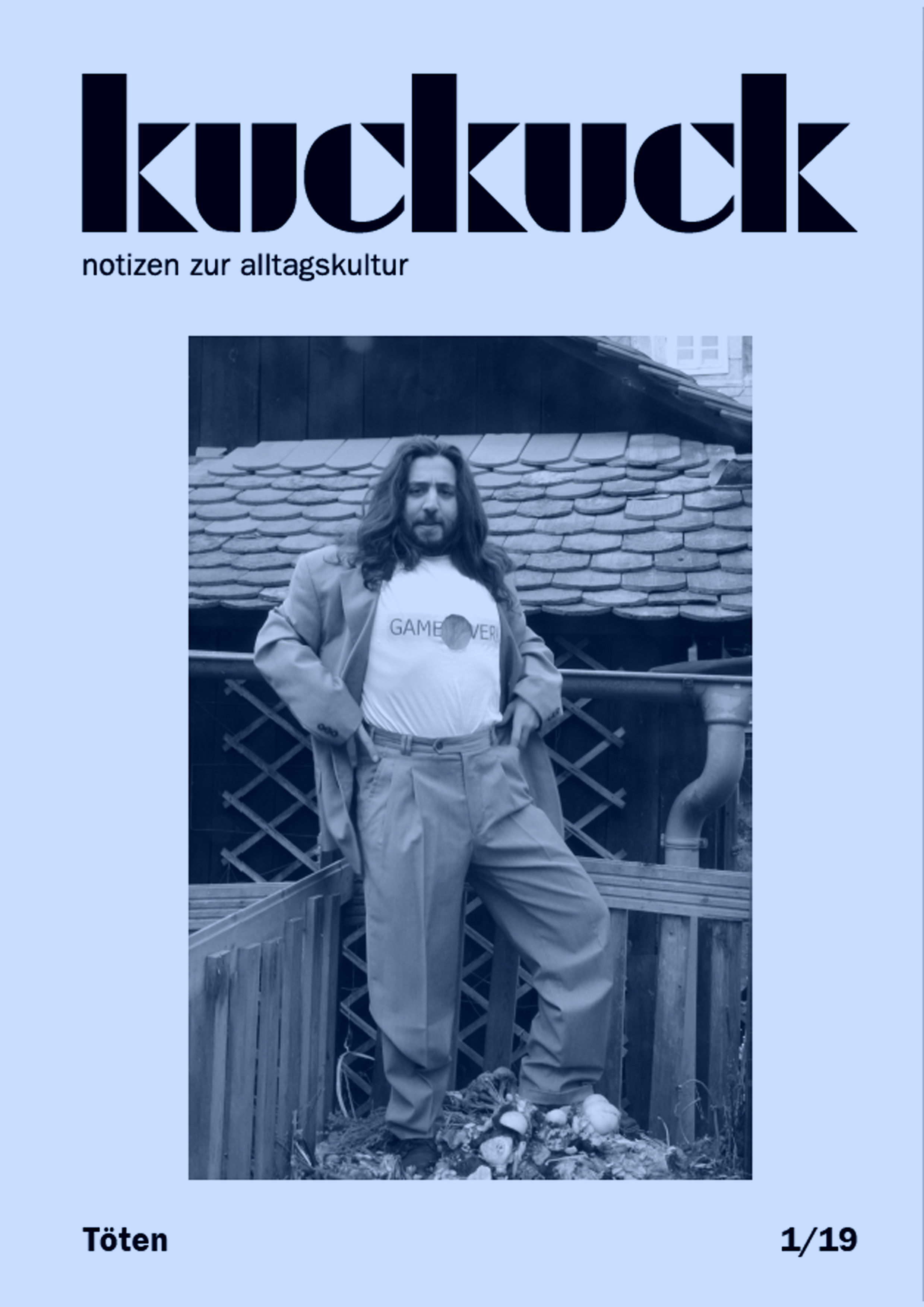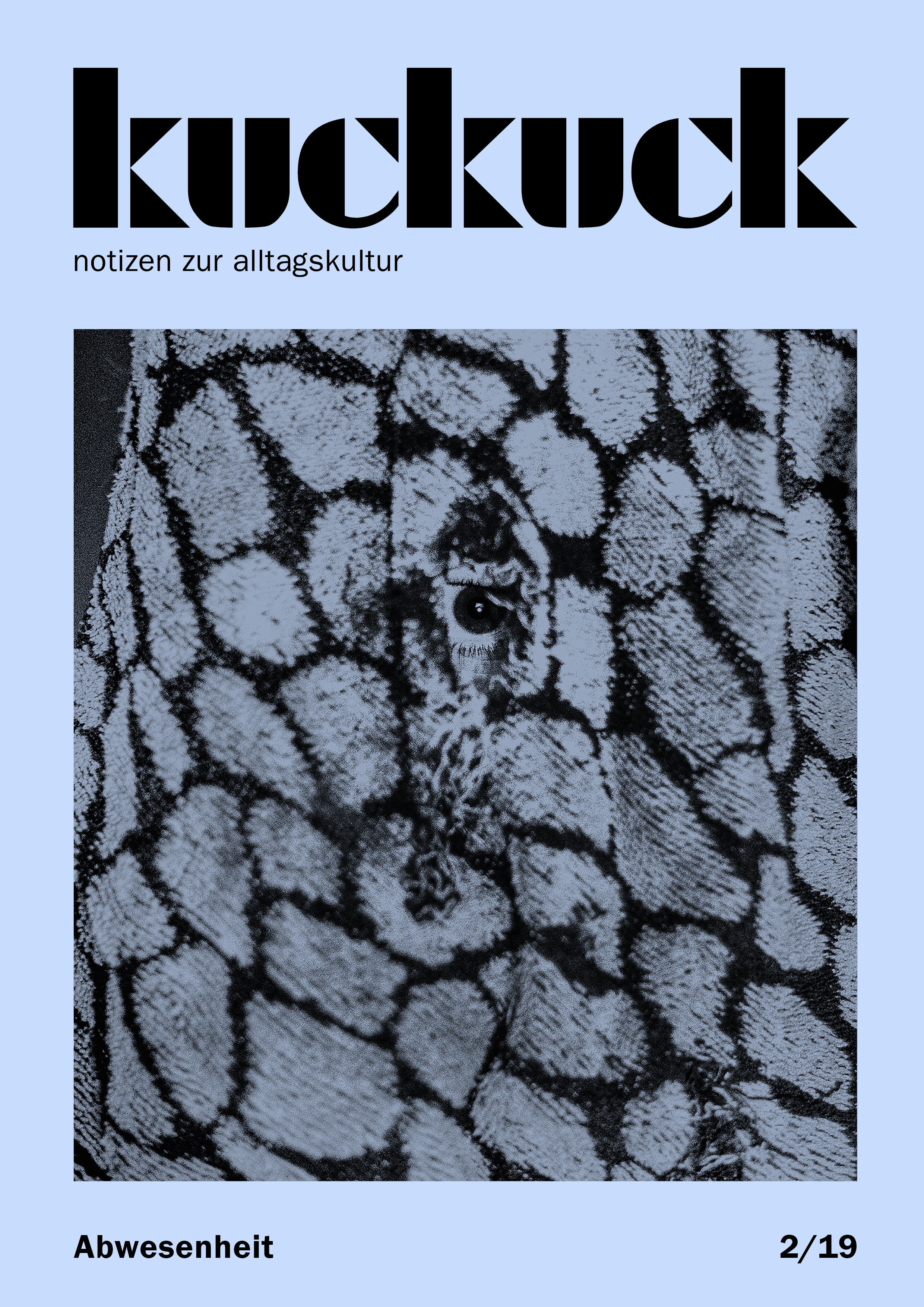
Farina Asche und Johanna Strunge
Mehr als nur leere Bilderrahmen? Eine Annäherung an Abwesenheiten und ihre Visualisierungspraktiken in Ausstellungen
Wir besuchen im Juni dieses Jahres die Konferenz „What’s missing?“ des Museums Europäischer Kulturen (MEK) in Berlin. Die zwei Tage sind dicht gefüllt vor allem mit Berichten aus der Museums- und Ausstellungspraxis. Im Zentrum stehen diverse Versuche, feministische, queere und postkoloniale Perspektiven in Museen und Ausstellungsräumen mit einzubinden. Aus der Abschlussdiskussion der Konferenz bleiben uns die Fragen einer Teilnehmerin besonders im Kopf: Was sei denn, wenn all die Versuche, die abwesenden Perspektiven wieder zu Tage zu bringen, scheiterten (oder die finanziellen Ressourcen für die Versuche fehlten)? Wie ließen sich fortbestehende Leerstellen in Ausstellungen visualisieren?
Die Fragen lassen uns an einen Ausstellungsbesuch im Historischen Museum Frankfurt drei Monate zuvor zurückdenken, in dem das Thema des Abwesenden sogar zum Fokus einer ganzen Sonderausstellung mit dem Titel „Vergessen. Warum wir nicht alles erinnern“ gemacht wurde. Im letzten Drittel des Ausstellungsrundgangs stoßen wir auf eine vom Künstler Mark Dion geschaffene Dunkelkammer und seine davor angebrachte, gerahmte Liste, die er mit „A Taxonomy of Lost and Forgotten Museum Objects“ betitelt. Die Taxonomie zählt in vierzehn Punkten unter anderem fehlerhaft inventarisierte Objekte, niemals ausgestellte Objekte und auch durch Mikroorganismen in Museumsräumen zerstörte Objekte auf. In der kleinen Dunkelkammer sind einige dieser Objekte ausgestellt. Mit schummrigen Taschenlampen lassen sich die Objekte aber nur erahnen und bleiben dabei weiterhin das vom Museum produzierte Unsichtbare/Abwesende.
Beide Beobachtungen – die Einbindung marginalisierter Perspektiven (Konferenz „What's missing“) und die Reflexion der eigenen Rolle des Museums im Prozess des Abwesendmachens (Ausstellung „Vergessen“) stehen der vermeintlichen ‚Natur‘ des Museums zunächst einmal diametral gegenüber. Viele Museen entstanden im turbulenten 19. Jahrhundert und ihre Aufgabe war hier klar definiert – sie sollten Dinge vor dem Vergessen bewahren und eindeutige Erzählungen liefern. Inzwischen blicken viele Museen auf eine über hundert Jahre währende Tätigkeit des Sammelns und Bewahrens zurück und doch ist ihnen seit jeher auch das Vergessen und die Produktion von Nicht-Wissen strukturell eingeschrieben. Unter Nicht-Wissen verstehen wir hierbei ein mehr oder auch weniger bewusstes Defizit an Kenntnis und Information zu bestimmten Themen, das zu einer Auslassung dieser Themen auf verschiedenen Ebenen der Institution Museum führen kann – begonnen bei der Sammlungspraxis bis hin zur kuratorischen Arbeit.
Im Zentrum unseres Artikels stehen Abwesenheiten in Ausstellungen. Anhand von kurzen Vignetten versuchen wir verschiedene Ansätze der Visualisierung zu greifen und einer Wende zum Ausstellen von Nicht-Wissen nachzugehen.
Kuratorische Praxis als Praxis der Auswahl
Kuratorische Praxis in Museen ist primär eine Praxis der Auswahl. Aus dem großen ‚Bauch‘ der Museen, ihren Sammlungen und Archiven, schaffen es nur wenige Stücke und Geschichten in das „Präsentationsmedium“[i] Ausstellung. Die Praxis des Ausstellens produziert daher schon aus dem Prinzip ihres Entstehens heraus immer Lücken und Leerstellen des Wissens. Als Ausdruck bestimmter „statements of position“[ii] waren und sind Ausstellungen nie neutral, sondern vielmehr in hegemoniale Inszenierungen und Machtverhältnisse verstrickt. Sie repräsentieren damit eine bestimmte historische Konstellation. Dabei sind unter anderem die Herausbildung eurozentristischer Bürgerlichkeit und Reproduktion sozialer Hierarchien, das zum Verschwindenbringen kolonialer Vergangenheit und Erinnerung und die Inszenierung des Nationalen als Verschleierungen und Abwesenheiten bestimmter Themen, Stimmen und Perspektiven bereits als Teil des Kuratierens analysiert und herausgestellt worden.[iii]
Ausgehend von diesen Gedanken fragen wir uns: Wie gehen Museen und Ausstellungen mit diesen Abwesenheiten um? Warum wird in der Debatte um das Fehlende im Museum über ein visuelles Zeigen der Abwesenheiten kaum gesprochen? Wie kann das Wissen darum, dass etwas eben nicht gewusst wird, in expositorische Praktiken Eingang finden?
In einer ersten Annäherung an eine Systematik dieser Abwesenheiten haben wir uns in verschiedene Museen und ihre Ausstellungen in Deutschland begeben: in ein Berliner Regionalmuseum, das Ethnologische Museum in Hamburg, das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam und an ein zum Museum gemachtes Grenzdurchgangslager in Niedersachsen. Die gefundenen Leerstellen sind in diesem Text je nach ihrer Funktion innerhalb der Ausstellungen in zwei Teile unterteilt – der erste beschäftigt sich mit der Sichtbarmachung von marginalisierten Geschichten und der zweite mit der Institutions- und Selbstkritik.
1. Marginalisierte Geschichten sichtbar machen
Abwesenheit 1: Die Ausstellung „zurückGESCHAUT“ des Museums Treptow in Berlin gipfelt in einem Raum, der den Teilnehmenden einer sogenannten Völkerschau im Rahmen der Gewerbeausstellung von 1896 gewidmet ist. Neben fotografischen Porträts in Din A4-Format blicken die Besuchenden viele weiße Seiten an (vgl. Abb. 1). Die Porträts sind übereinander und in Reihen angeordnet. Die große Anzahl der Lücken – nahezu die Hälfte aller Felder in der Reihe sind Leerstellen – lässt sie zu einem raumprägenden Element werden.

Die Lücken befinden sich hier in einem besonderen Setting – bereits die sie umgebenden Fotografien stehen für eine sonst marginalisierte Perspektive der Teilnehmenden einer Völkerschau. Die Leerstellen weisen auf das Scheitern hin, diese marginalisierte Perspektive in Gänze abzubilden, und werden dabei zum Platzhalter für weitere fehlende Perspektiven. Der genaue Blick zeigt, dass die Lücken in diesem konkreten Falle personalisiert sind. Jedes weiße Blatt trägt schriftliche Informationen zu einer Person. Die weiße Stelle, an der sonst die Fotografie abgebildet wäre, steht also für die Abwesenheit eines ganz bestimmten Abbildes.
Die Lücke ist vielleicht die offensichtlichste Visualisierung einer Abwesenheit. Sie zeigt an, dass etwas fehlt. Etwas, das essentiell dazugehören würde, aber nicht gefüllt werden kann. Es ist auch die Idee der Leerstelle (ob als fehlendes Bild, weißes Blatt, unbestückte Vitrine oder Sockel ohne Statue), die als Antwort auf die Frage nach der Visualisierung des Abwesenden auf der oben genannten Konferenz im MEK fällt.
Aber wie lässt sich Abwesendes jenseits von Lücken sichtbar machen?
Abwesenheit 2: Ein Besuch in dem in vielerlei Hinsicht im Umbruch befindlichen Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK), ehemaliges Museum für Völkerkunde Hamburg. Im Erdgeschoss stoßen wir auf eine als „Sehstörung“ betitelte Vitrine. In ihr stehen eine Reihe Gefäße und Gegenstände, die in kaiserlichen Werkstätten Chinas hergestellt worden sind. Der Blick auf diese Gefäße wird jedoch eindrücklich gestört. Auf dem Glas der Vitrine und auch an den angrenzenden Wänden spiegeln sich wechselnde historische Aufnahmen. Fotografien, die deutsche Truppen um 1900 zeigen.
Gewissermaßen ist dieses Beispiel das Gegenteil einer Lücke. Es gibt hier ein Zuviel an Bildern, ein Überlagern. Die chinesischen Gefäße lassen sich nicht jenseits des Schattenspiels der Bilder betrachten und auch die Bilder werden durch die dreidimensionalen Objekte in ihrem Hintergrund ergänzt. Ein sich gegenseitig kommentierendes Verhältnis entsteht, das auf den zweifelhaften Erwerbungszusammenhang der Objekte im Rahmen der Niederschlagung eines antikolonialen Widerstandes, den sogenannten Boxeraufstand (1899-1901), verweist.[iv] Ein Gewaltkontext, der bei bisherigen Präsentationen abwesend war und nun in Form von historischen Fotografien der Tätergruppe den Blick auf die Objekte wesentlich färbt.
Lücke und Überlagerung sind dabei Techniken, die mit ursprünglichen repräsentativen Techniken des Kuratierens brechen – ein Platz, der ein Objekt in bestem Lichte präsentieren könnte, wird frei gelassen (Lücke) und der Blick auf ein Objekt verstellt und erschwert (Überlagerung). Der Einzug solcher Techniken ist auch das Resultat sozialer Kämpfe in einer Zeit erstarkender Alternativkulturen, der Kritik am Geschichtsbild vorangegangener Generationen und einer sich pluralisierenden Welt im Kontext globaler Dekolonialisierungsbewegungen. Museumsgründungen bürgerschaftlicher Initiativen, poststrukturalistische, feministische sowie postkoloniale Kritiken haben seit den 1970er Jahren die kuratorische Praxis um Erfahrungswissen von Unterdrückung und Widerständigkeit zu ergänzen versucht, machten das Museum dadurch zu einem umkämpften Ort und führten in die Krise(n) der Repräsentation. Eine erste solche Krise lässt sich bereits im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert verorten. Hier wurde in der philosophischen Wissenschaft zunehmend infrage gestellt, ob menschliche Repräsentationssysteme, wie die der Sprache, überhaupt dazu geeignet seien, außersprachliche Wirklichkeiten abzubilden.[v] Der Begriff der Repräsentation, der neben der Idee des Abbildes auch die Bedeutung der Stellvertretung/Vertretung und auch das Vergegenwärtigen von Abwesendem enthält, kam letztlich nie mehr wirklich aus der Krise.[vi] Das Museum fällt schließlich vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in „mannigfache[ ] Krisen der Repräsentation“[vii]. Ähnlich wie in den vorangegangenen Krisen wird auch hier die Neutralität, Objektivität und der zeitlose Wahrheitsanspruch, die das Museum als „Repräsentationsagentur par excellence“[viii] herzustellen versucht, entlarvt.[ix] Das Museum wird in dieser Konsequenz neu verstanden als eine bedeutungsschaffende Institution, die dabei wesentlich in Machtverhältnisse verstrickt ist. Machtverhältnisse, die einiges willentlich einschließen, anderes aussortieren und ausschließen.
Repräsentationskritisches Ausstellen versucht in Gegenbewegung dazu zu fragen: „Welche Geschichten werden erzählt? Welche sozialen Gruppen werden sichtbar? Und welche Machtverhältnisse manifestieren sich?“[x] Dabei zielt die Frage der Sichtbarmachung auch auf die visuelle Umsetzung einer solchen Kritik in einer Ausstellung.
Lücken und Überlagerungen – und viele weitere Techniken, die hier unerwähnt bleiben müssen – können je nach Kontext genau solche repräsentationskritischen Techniken sein, um eine machtkritische Perspektive einzunehmen und marginalisierte Perspektiven im Ausstellungsraum anwesend und sichtbar zu machen.
Wie der kurze Abriss der Geschichte dieser Repräsentationskrisen deutlich gemacht hat, ist die Hinwendung zu den marginalisierten Perspektiven dabei oft auch aus einer Kritik an Institutionen heraus entstanden und ging damit einher, dass Orte wie Museen, ihre eigene Rolle hinterfragen mussten. Ob und wie diese Reflexionen sichtbarer Teil der Präsentationen eines Museums werden können, werden wir nun im zweiten Teil diskutieren.
2. Institutions- und Selbstkritik sichtbar machen
Abwesenheit 3: Auf einer Veranstaltung wird uns von der Ausstellung „uni-form- Körper, Mode und Arbeit nach Maß“, die 2016 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam gezeigt wurde, erzählt. In dieser verfolgten die Kurator_innen die Entwicklung des Schneiderhandwerks parallel zur Geschichte der Vermessung des menschlichen Körpers. Was uns von diesem Gespräch besonders in Erinnerung bleibt, ist die beschriebene Eingangsszenografie der Ausstellung, der erste Raum. In diesem werden die Besuchenden anhand von Ausstellungsmodellen durch all jene Visionen der Gestalter_innen geleitet, die zeigen, wie die Ausstellung hätte aussehen können.
Durch diesen Prolog werden die Besuchenden auch mit den verworfenen Ideen der Ausstellungsgestaltung konfrontiert und können so Prozesse der kuratorischen Auswahl nachvollziehen. Der ansonsten abwesende Konstruktionsprozess mitsamt der Entstehungsgeschichte und den Gestaltungsbedingungen einer Ausstellung wird dadurch fragmentarisch sichtbar.
Abwesenheit 4: Wir befinden uns im ersten Raum des Friedland Museums im Süden Niedersachsens. Mittelpunkt ist ein digitalisiertes Buch, die Chronik des Grenzdurchgangslagers, durch welche eine Hand ohne Handschuh unregelmäßig blättert. Wir können Seiten gefüllt mit Fotos, Zeitungsausschnitten und kurzen Textpassagen erkennen. Abschließend blättert die Hand durch leere Seiten. Unterhalb dieser Inszenierung fällt nun eine Vitrine mit demselben Buch auf, nun jedoch verschlossen und unberührbar. Auf dem Weg durch das Museum Friedland, das sich mit der Geschichte und Gegenwart des Grenzdurchgangslagers Friedland befasst, begegnet uns die Chronik in digitalisierter Form innerhalb interaktiver Displays erneut. Nun lassen sich Klebemarkierungen in einigen Seiten erkennen.
Durch das Prinzip des mehrfachen Ausstellens des Buches wird der unterschiedliche Umgang mit einem solchen Objekt (wertvolles museales Objekt versus interaktiv verwendbarer Gegenstand) deutlich. Es wird ersichtlich, dass die kuratorische Praxis, indem sie verschiedene Ausstellungssettings schafft, darüber entscheidet, welches Wissen über ein Objekt transportiert wird. Die Strategie des doppelten Ausstellens macht also die Praxis des Kuratierens und den Konstruktionscharakter der Ausstellung sichtbar. In dem Text zur Ausstellung übersetzt der leitende Kurator Joachim Baur dies noch einmal in Fragen: „Wer schreibt Geschichte und wie schreiben wir Geschichte? Wie schreiben wir heute Geschichte mit den Quellen und Materialien von gestern? Welche Annahmen, Vorstellungen, Sichtweisen und Interessen prägten seit den 1950er Jahren die Geschichtsdarstellung der Lagerchronik, welche die Ausstellung des Jahres 2016?“[xi]
Abwesenheit 5: Wir bleiben im Friedland Museum und begeben uns in die 2. Etage, in den Raum „Sieben Sachen“. Wir finden sieben Objekte: einen Koffer, eine Schallplatte, einen Silberlöffel, eine Spielzeugfigur, einen Pullover, eine Boxershorts, einen Karton voller Papiere. Sie stehen im Dunkeln und werden nacheinander einzeln beleuchtet. Mit einer erzählenden Stimme über eine Audioinstallation wird ihnen jeweils eine Geschichte gegeben.
Die „Sieben Sachen“ stellen die Lieblingsobjekte der Kurator_innen dar, die hier selbst mit ihren Stimmen zu Wort kommen und die Auswahl der Objekte persönlich begründen. Dieser Bruch mit der „musealen Konvention der objektiven Darstellung und auktorialen Rede“[xii] zeigt ein selbstkritisches Kuratieren, in dem die Positionalität der Ausstellung und die subjektive Auswahl von Objekten sicht- und hörbar werden.
Wenn auch zunächst vor allem in Sonderausstellungen, so machen diese Beispiele doch deutlich, dass sich verstärkt Visualisierungsstrategien finden lassen, die das eigene Nicht-Wissen und die Positionalität und Situiertheit des Wissens[xiii] der Ausstellungsmachenden thematisieren. Dieser Sichtbarmachung von Selbstreflexion und Selbstkritik kuratorischer Praxis ging eine historische Entwicklung voraus, die sich bis zur künstlerischen Institutionskritik der 1960er Jahre nachzeichnen lässt. Waren es zunächst vor allem avantgardistische Künstler_innen, die sich selbstkritisch mit ihrer Rolle im Kunstbetrieb auseinandersetzten, läuteten die 1980er Jahre die Kritik an der Macht der Museen und Ausstellungshäuser ein, als deren Teil auch die kuratorische Arbeit verstanden wurde.
Zunächst lediglich als Gegenstand der Kritik beschäftigten sich Kurator_innen spätestens seit den 1990er Jahren dann auch mit ihrer eigenen Rolle und eigneten sich Strategien und Taktiken der Selbstkritik und -reflexion an. [xiv] Einige Autor_innen sprechen im Kontext dieser Aneignungsprozesse künstlerischer Reflexionstechniken von einem regelrechten Hype der Reflexion kuratorischer Praxis und einem reflexive turn.[xv] Dabei wurde auch die gesellschaftliche Rolle und Verantwortung von Museen diskutiert.[xvi] Der Ansatz der New Museology setzte Inklusion und Demokratisierung auf die museale Agenda.[xvii]
In den aufgeführten Beispielen lässt sich das selbstkritische Kuratieren durch die Sichtbarmachung des Konstruktions- und Auswahlprozesses („uni-form“-Ausstellung, mehrfaches Ausstellen der Chronik), der Lücken (leere Seiten in der Chronik) und der kuratorischen Stimme (Raum „Sieben Sachen“) erkennen, so wie es einige Wissenschaftler_innen in ihren Ausstellungsanalysen schon seit Längerem fordern. So plädieren die Museolog_innen Roswitha Muttenthaler und Regina Wonisch, Ausstellungen sollen als persönliche Statements verstanden und das Museum zu einer „selbstreflexiven Institution“[xviii] mit „verantwortlichem Blick“[xix] werden. Dies sei wichtig, „da die kompetenzfördernde Auseinandersetzung mit visueller Kultur auch die Repräsentation des Museums selbst betreffen würde.“ Es gehe also darum „in Repräsentationen die Annahmen offenzulegen, sodass diese vom Publikum als Deutungsangebote begriffen werden können.“ Denn, so schreiben die Museolog_innen weiter, „nur wenn das Medium Ausstellen ernst genommen wird, können Ausstellungen als Kristallisationspunkte für die öffentliche Auseinandersetzung […] so etwas wie eine Schule des Sehens werden.“[xx] Das Ausstellen greift in diesem Sinne in gesellschaftliche Debatten ein und stellt eine bestimmte, historisch verortbare Perspektive dar.
Visualisierungspraktiken verknüpfen und darüber hinaus gehen
Die beschriebenen Ausstellungspraktiken machen eine von uns zu Beginn postulierte Wende zum Ausstellen von Nicht-Wissen erkennbar. Ihnen allen ist der Versuch gemein, vormals Abwesendes sichtbar zu machen. Unterscheiden lassen sich diese Strategien durch ihre verschiedenen Funktionen – die einen agieren entlang eines stärker postkolonialen, feministischen Anspruchs, die anderen mit einem sozialkonstruktivistisch, selbstreflexiven und institutionskritischen Blick.
Nach unserem Rundgang durch die Visualisierungspraktiken des Abwesenden in Ausstellungen halten wir es abschließend für produktiv und vielversprechend, repräsentationskritische mit institutionskritischen Ansätzen in der kuratorischen Arbeit zu verbinden. Das Potenzial im Zusammenführen sehen wir vor allem darin, repräsentationskritische Praktiken, die marginalisierte Geschichten sichtbar machen, um die strukturelle Verwobenheit der kuratorischen Arbeit sowie der Institution Museum selbst zu erweitern. Eine kritische Wissensproduktion sollte beide Seiten in den Blick nehmen und die mehrfache Bedeutung des Begriffs der Repräsentation ernstnehmen. Demzufolge muss kuratorische Praxis sowohl auf der darstellenden Ebene (Ausstellung) als auch vertretenden Ebene (Strukturen innerhalb der gesamten Institution) die Repräsentationsstrategien von Museen und Ausstellungen kritisch verhandeln.
Nehmen wir diesen Anspruch ernst, müssen wir uns jedoch eingestehen, selbst Abwesenheiten in unserem Text produziert zu haben. Durch unseren Fokus auf Praktiken der Visualisierung haben wir das Kuratieren auf diesen spezifischen Bereich begrenzt. Begreifen wir jedoch das Kuratorische wie die Medienwissenschaftlerin Katja Molis in Anschluss an Schriften der Kunsthistorikerin Irit Rogoff als „transdisziplinäre und entgrenzte Praktik“, als „eine Form des ‚kritischen‘ Denkens und Forschens […] über die die Strukturen und Prozesse mitgestaltet und transformiert werden können“[xxi] sind die hier fokussierten Strategien als ein Teil kuratorischer Praxis zu begreifen. Die Institution Museum produziert auch jenseits des Präsentationsmediums Ausstellung – zum Beispiel auf der Ebene der Sammlung, der Personalpolitik oder der Wissensproduktion – Abwesenheiten, die es ebenfalls zu untersuchen gilt.[xxii] Ganz im Sinne der vorangegangenen Repräsentations- und Institutionskritik sollte es dabei um eine involvierte Auseinandersetzung mit der machtvollen Verwobenheit von kuratorischer Praxis in Museen und den darin produzierten Abwesenheiten gehen.
[i] Scholze, Jana (2015): Medium Ausstellung. Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, Leipzig, Amsterdam und Berlin, Bielefeld: transcript, S. 11.
[ii] Macdonald, Sharon (1996): Theorizing museums: an introduction, In: Macdonald, Sharon und Gordon Fyfe (Hg.): Theorizing museums. Representing identity and diversity in a changing world. Oxford: John Wiley & Sons. S. 14.
[iii] Zur Herausbildung eurozentristischer Bürgerlichkeit und Reproduktion sozialer Hierarchien siehe
Bennett, Tony (2017): Ausstellung, Wahrheit, Macht: Ein Blick zurück auf den „Ausstellungskomplex“, In:
Latimer, Quinn und Adam Szymczyk: Der Documenta 14 Reader, S. 339-401; Zum Verschwindenbringen kolonialer Vergangenheit und Erinnerung siehe Habermas, Rebekka (2017): Benin Bronzen im Kaiserreich – oder warum koloniale Objekte so viel Ärgermachen, In: Historische Anthropologie, Band 25, Heft 3, S. 327-352; und zur Inszenierung des Nationalen siehe Baur, Joachim (2009): Die Musealisierung der Migration. Einwanderungsmuseen und die Inszenierung der multikulturellen Nation, Bielefeld: transcript.
[iv] Hintergrund des sogenannten Boxeraufstandes, heute auch zunehmend als Boxerkrieg bezeichnet, war die erzwungene Öffnung Chinas für den europäischen Handel am Ende des 19. Jahrhunderts. Gegen diesen europäischen Einfluss und vor allem auch die damit einhergehende Christianisierung des Landes formierten sich zunehmend Widerständskämpfer_innen, die von den Europäer_innen als „Boxer“ bezeichnet wurden. Eskalation erfuhr der Konflikt in den Jahren 1900/1901, in denen das Land von einer Dürre heimgesucht wurde, für die die „Boxer“ die Europäer_innen in der Verantwortung sahen. Bei den folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen kamen schätzungsweise über 20.000 Menschen ums Leben. Nach der Ermordung eines deutschen Gesandten griffen deutsche Truppen stark in den Konflikt ein und führten dann vor allem Strafexpeditionen ins Landesinnere durch, bei der sie zahlreiche „Boxer“ hinrichteten und voraussichtlich eine Großzahl an Gegenständen als Beute in Beschlag nahmen. Vgl. Preuße, Christian (2015): Der Boxeraufstand, Lebendiges Museum Online. Verfügbar unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/aussenpolitik/boxeraufstand.html, letzter Zugriff: 19.09.2019.
[v] Vgl. Behnke, Kerstin (1992): Repräsentation, In: Ritter, Joachim und Karlfried Gründer (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 8, Basel: Schwabe & Co AG, S. 846ff.
[vi] Vgl. Ebd. Und für eine Auffächerung der Begriffsbedeutungen von Repräsentation siehe u.a. Baur, Joachim (2015): Repräsentation, In: Heike Gfrereis u.a. (Hg.): Museen verstehen. Begriffe der Theorie und Praxis, Göttingen: Wallstein Verlag, S. 90. Auch die Ethnologie stürzte in den 1980er Jahren in eine Krise der Repräsentation. Zentral hierfür ist die Writing-Culture-Debatte. Siehe dazu Clifford, James und George E. Marcus (Hg.) (1986): Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkley: University of California Press.
[vii] Sternfeld, Nora (2018): Im postrepräsentativen Museum, In: Dies.: Das radikaldemokratische Museum, Berlin/Boston: DE GRUYTER, S. 56.
[viii] Baur (2015), S. 96.
[ix] Vgl. auch Sternfeld (2018), S. 56.
[x] Sieber, Thomas (2017): Migration exponieren. Formen der Repräsentation zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, In: Mörsch, Carmen; Sachs, Angeli und Thomas Sieber (Hg.): Ausstellen und Vermitteln im Museum der Gegenwart, Bielefeld: transcript, S. 116.
[xi] Baur, Joachim (2017): Fluchtpunkt Friedland. Ein Rundgang durch 70 Jahre und eine Ausstellung. In: Ausstellungskatalog der Dauerausstellung im Museum Friedland: Fluchtpunkt Friedland. Über das Grenzdurchgangslager 1945 bis heute, Göttingen: Wallenstein Verlag, S. 38.
[xii] Ebd.
[xiii] Vgl. Haraway, Donna (1995): Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive, In: Hammer, Carmen und Immanuel Stieß (Hg.): Die Neuerfindung der Natur: Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt/Main: Campus Verlag, S. 73-97.
[xiv] Vgl. Molis, Katja (2019): Kuratorische Subjekte. Bielefeld: transcript, S. 117f.
[xv] Vgl. Sternfeld (2018), S. 23; Molis (2019), S. 121.
[xvi] Die Reflexion des kuratorischen Prozesses und die Visualisierung des Nicht-Wissens wird jedoch zuweilen auch kritisiert. So werde sie ganz im neoliberalen Duktus vieler Museen bereits zu Marketingzwecken eingesetzt und entwerte so die eigentliche Institutionskritik. Siehe hierzu Molis (2019), S. 124ff.
[xvii] Vgl. Macdonald, Sharon (2010): Museen erforschen. Für eine Museumswissenschaft in der Erweiterung, In: Baur, Joachim (Hg.): Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld: transcript, S. 49-–69.
[xviii] Muttenthaler, Roswitha und Regina Wonisch (2007): Gesten des Zeigens. Zur Repräsentation von Gender und Race in Ausstellungen, Bielefeld: transcript, S. 253.
[xix] Ebd. in Anschluss an Irit Rogoff, S. 39.
[xx] Ebd., S. 253.
[xxi] Molis (2019) in Anschluss an Rogoff, S. 127.
[xxii] Für eine erste Systematisierung anderer Abwesenheiten im Museum siehe Macdonald, Sharon (2019): Wie Museen vergessen. Sieben Weisen, In: Alley, Jasmin und Kurt Wettengl (Hg.): Vergessen. Warum wir nicht alles erinnern. Ausstellungskatalog, Petersberg: Michael Imhof Verlag, S. 182-–190.

 English
English  Deutsch
Deutsch